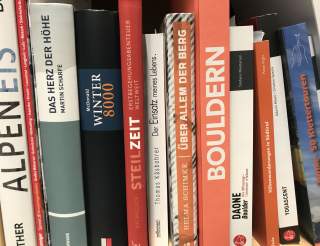Die Diplom-Meteorologin Dr. Heidi Escher-Vetter war fast 40 Jahre (1974-2014) in der Gletscherforschung am Vernagtferner tätig. Sie schreibt: „Man kann sich gut vorstellen, dass in der mehr als hundertjährigen Geschichte der Gletscherforschung eine sehr große Anzahl an hochkarätigen Fachpublikationen entstanden sind. Warum dann dieses Buch? Sein Hauptzweck ist, viele zum Teil nicht zugängliche Informationen zusammen zu stellen, die sich mit den Forschungsaktivitäten rund um den Vernagtferner beschäftigen“. Es war der Autorin auch wichtig, diverse Hintergrundinformationen zu erwähnen, die aus ihrer Sicht nicht in Vergessenheit geraten sollen.
Erstmals hat Sebastian Finsterwalder in der Zeitschrift des D u. OeAV, Band XX, im Jahr 1889 unter dem Titel „Aus den Tagebüchern eines Gletschervermessers“ über den Vernagtferner berichtet. Diese Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert lieferten eine wesentliche Basis für die Arbeiten im 20. und 21. Jahrhundert. Das erste Kapitel schildert die Entwicklung des Gletschers zwischen 1601 und 1889.
Pionier der Gletscherforschung Sebastian Finsterwalder
Die Hauptakteure, also die Gründerväter mit Sebastian Finsterwalder an der Spitze, werden im zweiten Kapitel vorgestellt. Die Vorgeschichte und der eigentliche Bau der Pegelstation-Vernagtbach im Zeitraum von 1938 bis 1975 folgen in den Kapiteln drei und vier. Das fünfte Kapitel gilt den Mitarbeiter*innen, die z. T. über Jahrzehnte in der Gletscherforschung tätig waren, wobei manche Probleme bei der Finanzierung gemeistert werden mussten. Deshalb schließt daran direkt die Zusammenfassung der geldgebenden Institutionen an. Der Schwerpunkt der weiteren Kapitel liegt danach auf technischen Aspekten, wie Messtechnik, die Aufzeichnung der Werte, Stromversorgung und Kalibrierung, d.h. auf dem Dauerbetrieb in einer so exponierten Station auf 2640 m Meereshöhe. Dabei erfährt man z. B., dass die Fließgeschwindigkeit des Gletscherbaches am genauesten mit der Einbringung von Salzwasser etwa 100 m oberhalb der Messstelle ermittelt werden kann. Ich kannte bisher nur die Fließgeschwindigkeitsmessung mit dem hydrometrischen Flügel. Man lernt weitere meteorologische Stationen, wie Gletschermitte und Schwarzkögele kennen. An letzterer sind seit 1976 Kameras installiert, die den extremen Gletscherschwund dokumentieren. Die Abbildungen auf den Seiten 90 und 91 wurden von diesem Standort aus gemacht. Es wird auch geschildert wie eine Messstation „Am Weg“ von einer Lawine zerstört wurde. Man muss bedenken, dass dieser Abschnitt sehr stark in die meteorologische und hydrologische Fachwelt eintaucht. Interessant sind die Fahrten zwischen München und Vent und im eigentlichen Gletschergebiet.
Die Unterstützung durch die Sektion Würzburg und die Wirtsleute der Vernagthütte war nicht zu unterschätzen. So baute die Sektion 1967 einen neuen Transportlift, nachdem der Wegebau zur DAV-Hütte an den natürlichen Gegebenheiten gescheitert war. Der alte kürzere Transportlift wurde abgebaut und als Verbindungslift Pegelstation – Vernagthütte eingerichtet, was die Arbeiten für die Forschenden erheblich erleichterte. Bei dem Kapitel „Begehungen“ werden viele an selbstgemachte Erfahrungen in Selbstversorgerhütten erinnert. Das gleiche gilt für die Skitourenberichte, Spaltenbergung und Lawinen. Die weltweite Vernetzung der Forschenden ist sehr wichtig für den wissenschaftlichen Austausch.
Im Kapitel „Spezialuntersuchungen und Experimente“ wird der Gletscherrückgang in Länge und Dicke z.T. dramatisch beschrieben, wenn die Gletscherhöhlen einstürzten.
Die Feierlichkeiten durften nicht fehlen, interessant war, dass auch dabei mit der Vernagthütte und deren Wirten, sowie der Sektion Würzburg ein ausgezeichnetes Verhältnis bestand und besteht. Sie halfen vielfältig aus, z.B. mit der Unterkunft der Besucher, wenn größere Gruppen bis hin zu ganzen Schulklassen kamen, denn in der Pegelstation konnten maximal zehn Personen untergebracht werden.
Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an die DAV-Naturschutzreferenten-Tagung in Vent vom 24.-27.09.2004. Eine eigene Exkursion ging am 27.09 zuerst auf die Vernagthütte, dann weiter zur Pegel- und Klimastation am Vernagtbach. Bei der DAV-Naturschutzreferenten-Tagung in Rosenheim hielt Dr. Ludwig Braun (Leiter der Vernagtforschung) am 20.09.2008 den Vortrag „Gletscher als Indikatoren für den Klimawandel“.
Im Buch wird auch der Besuch der DAV-Naturschutzreferenten am 01.07.2012 und des Summit Clubs am 24.07.2012 erwähnt.
Zum Schluss muss betont werden, dass ein wesentlicher Aspekt der Vernagt-Forschung in ihrer großen Kontinuität besteht. Das ist nur möglich, weil die Gletscher- und Klimaforschung, wie sie von der Vernagt-Gruppe betrieben wird, ein klassisches Projekt der Bayerischen Akademie der Wissenschaft ist, die sich der Langzeitforschung verschrieben hat. Kein Institut einer Universität könnte über Jahrzehnte diese Arbeit gewährleisten!
Eine gute Ergänzung zu dem Buch ist die AV-Karte Ötztaler Alpen Wildspitze.
Informationen
Gletschergeschichten aus dem Ötztal rund um den Vernagtferner
Erzählt von Heidi Escher-Vetter (Herausgeber und Redaktion), 192 Seiten
VLG Verlag & Agentur GmbH, Haar/München
ISBN 978-3-96751-001-0
Preis: 19,50 €