Bergpodcast: Expertentipps von DAV-Ausbildungsleiter Bergsport Alpin Markus Fleischmann

Experten-Tipps für deine hohen Bergziele
Mein Projekt 4000er
Bergpodcast Folge 51: Wenn die Sehnsucht nach hohen Bergzielen wächst, stellen sich viele Fragen. Hier gibt's Expertenwissen und Tipps für Einsteiger*innen und Fortgeschrittene.
Spätestens wenn man - gefühlt - alle Gipfel der Ostalpen durch hat, kommt der Wunsch nach den höheren Bergzielen auf. Höhere Bergziele in den Alpen heißt für gewöhnlich: Viertausender. Von den 82 Exemplaren in den Alpen (laut Hauptliste der UIAA, Union Internationale des Associations d’Alpinisme) steht genau eines in den Ostalpen, der Piz Bernina mit 4048 Metern. Alle anderen – inklusive bekannter Gipfel wie Mont Blanc (4805 m), Dufourspitze (4634 m), Matterhorn (4478 m), Jungfrau (4158 m) oder Gran Paradiso (4061 m) – sind in den Westalpen zu finden. Die Grenze zwischen West- und Ostalpen liegt übrigens auf einer gedachten Linie vom Bodensee entlang des Rheins über den Splügenpass zum Comer See.
Was erwartet mich bei einem Bergziel von 4000 Metern oder mehr?
Zunächst einmal: Gletscher. Auch wenn die Klimaerwärmung vielen der Eisriesen nach und nach den Garaus macht, darf man bei den meisten Viertausendern der Alpen noch mit Gletscherkontakt rechnen. Heißt natürlich auch: Man muss wissen, wie man sich in dieser Umgebung verhält.
Generell ist man beim Bergsteigen in großen Höhen sehr beeinflusst von Wetter, Umwelt, starkem Wind, Temperaturen und Sonneneinstrahlung. Hinzu kommt die Luft, die oben dünner wird. Um nicht höhenkrank zu werden – und damit den Erfolg der Tour zu riskieren – muss man den Körper an die Höhe gewöhnen.
Der Klimawandel wirkt sich generell auf die Gegebenheiten aus, die man im Hochgebirge vorfindet. Selbst in hohen Lagen kann es schon im Frühjahr und bis in den Herbst hinein zu ungewöhnlich hohen Temperaturen kommen, durch das Tauen des Permafrosts werden Steinschlagereignisse wahrscheinlicher, die schmelzenden Gletscher legen oft anspruchsvolleres Gelände frei, manche Routen werden unbegehbar. Die Klimaerwärmung beeinflusst auch die Saison an sich, also wann die Bedingungen überhaupt passen für eine Hochtour – so werden die beliebten Gipfel und Modetouren in den verkürzten Zeiträumen noch voller, Wartezeiten an Schlüsselstellen sind vorprogrammiert.
Nochmal bewusst machen sollte man sich auch, dass man eben im Hochgebirge unterwegs sein wird – und entsprechende bergsteigerische Kenntnisse und Fähigkeiten benötigt. Eine gute Basis für den ersten Viertausender ist eine selbständige Besteigung im Dreitausender-Bereich, zum Beispiel in den Ostalpen. Selbständig heißt, Touren eigenständig geplant und durchgeführt zu haben – in wirklicher Entscheidungsverantwortung.
Woraus ergibt sich die Schwierigkeit des Bergs?
Die Schwierigkeit eines Bergs ergibt sich aus verschiedenen Parametern. Zunächst ist es eine konditionelle Frage: Wie viele Höhenmeter muss ich am Stück und insgesamt bis zum Gipfel zurücklegen? Optimal wäre, wenn man weiß, dass man die angegebenen Höhenmeter schafft und sogar noch Reserven hätte. Der andere Teil der Schwierigkeit liegt in der Technik. Es gibt zwar auch „leichte“ Viertausender – auch für die braucht man aber natürlich bergsteigerisches Wissen und Können. Das Schmelzen des Eises führt außerdem oft zu Schwierigkeiten in den Randbereichen, beim Übergang zum Fels. Viele Viertausender erfordern neben Wissen über Gletscher übrigens auch Felskletterkenntnisse. Es ist sehr wichtig, sich die Tour bei der Vorbereitung genau anzusehen.
Was Schwierigkeiten und mögliche Herausforderungen angeht, kann und sollte man Dreitausender hinsichtlich Grundlagenausdauer, Fortbewegung im Hochgebirge, Umgang mit Steigeisen und Pickel etc. als Trainingsgelände nutzen.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Drei- und Viertausendern?
Kurz gesagt: tausend Höhenmeter. Das heißt in puncto Wetter und Verhältnisse werden die Bedingungen einfach nochmal schärfer. Die Vergletscherung ist in der Regel im Bereich der Viertausender auch heutzutage noch ausgeprägt. Hinsichtlich technischer Schwierigkeiten kann man dennoch keine pauschale Aussage treffen, da kommt es auf die konkrete Tour und das konkrete Gipfelziel an.
Welcher ist der richtige Viertausender für mich?
Um das herauszufinden, sollte man überlegen, was man gut kann – und welche Schwierigkeiten der gewünschte Gipfel aufweist. Ist die Begehung des Gletschers eine Schlüsselstelle? Brauche ich Kletterkönnen? Kann ich mit der benötigten Ausrüstung umgehen? Die jeweiligen Schwierigkeiten können sehr unterschiedlich sein. Dann sollte man auch seine letzten Touren gewissenhaft reflektieren: Wo habe ich gute Erfahrungen gemacht? Wann habe ich mich überschätzt und bin an meine Grenzen gestoßen? Diesen Grenzbereich kann man dann kleinschrittig weiter trainieren, bis man irgendwann in die Viertausenderzone vorstößt. Gipfel, die auch für den Einstieg geeignet sind, haben wir im Folgenden gesammelt.
Welche Viertausender sind für den Einstieg geeignet?
Vorweg: Für den Einstieg bedeutet ganz klar nicht Einstieg in den Bergsport, sondern in die Besteigung hoher Berge. An Viertausender tastet man sich langsam über das Sammeln von Bergwandererfahrung und die Besteigung von Dreitausendern heran. Wenn man das getan hat, sollte man mit den niedrigeren, technisch einfacheren Gipfeln starten, also Berge ohne besonders anspruchsvolle Gletscherpassagen, Gletscherbrüche und Felsgrate.
Beispiele
Allalinhorn, 4027 m (Schwierigkeit WS)
Gran Paradiso, 4061 m (Schwierigkeit L+)
Westgipfel des Zermatter Breithorns, 4164 m (Schwierigkeit L)
Strahlhorn, 4190 m (Schwierigkeit WS-)
Bishorn, 4153 m (Schwierigkeit L)
Signalkuppe, 4554 m (Schwierigkeit L)
Zumsteinspitze, 4563 m (Schwierigkeit L+)
Diese Gipfel sind teils auch an einem Tag machbar – Höhenanpassung/ Akklimatisation ist da allerdings nicht inklusive. Dafür muss man meist nochmal mindestens drei Tage einplanen, mehr zur Akklimatisierung hier.
Wer sich im Fels wohler fühlt, kann für den Einstieg auch Viertausender ohne Gletscherkontakt in Betracht ziehen. Klar ist, dass sich die Schwierigkeit hier vom Gletscher auf den Fels verlagert, man muss also Felsklettern können. Dazu zählen:
Lagginhorn, 4010 m (Schwierigkeit WS)
Weissmies Südgrat, 4017 m (Schwierigkeit WS+)
Was muss ich können für die Viertausender-Besteigung?
Geh- und Klettertechnik mit und ohne Steigeisen
Stufen schlagen
Sicherungstechnik am Gletscher und in absturzgefährdetem Gelände inklusive Knotenkunde, An- und Abseilen
Gletscher- und Wetterkunde
Erste Hilfe
Orientierung
Risikomanagement
...
Wer sich bei einem oder mehreren der aufgezählten Punkte unsicher hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten ist, ist vor der Tour mit einem Hochtourenkurs gut beraten.
Wie bereite ich mich auf „meinen“ Viertausender vor?
Auch für vermeintlich „leichte“ Viertausender muss man sich vorbereiten. Gerade wenn es das erste Mal in Gletscher- bzw. Hochgebirgsgelände geht, sollte man einen klassischen Gletscher-Hochtourenkurs absolviert haben. Die meist einwöchigen Kurse gibt es bei vielen DAV-Sektionen, beim DAV Summit Club oder anderen Bergschulen – man lernt den Umgang mit der Ausrüstung (Seil, Steigeisen, Pickel) genauso wie das Verhalten auf Gletschern (Vermeidung von Spaltenstürzen, Gehen in der Seilschaft etc.).
Das Gelernte muss man jedoch selbständig und regelmäßig in unkritischem Gelände trainieren und vertiefen. Basics wie Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sollten genauso selbstverständlich sein wie die sichere Fortbewegung auch in weglosem Gelände. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit lernt man übrigens am besten durch Learning by doing in Gelände, das man gut bewältigt, und steigert sich langsam.
Auch die eigene Kondition sollte man vor der Tour auf einen hohen Gipfel hinsichtlich der langen Gehzeiten kritisch hinterfragen – und ggf. aufmöbeln. Trainieren kann man erstmal in niedrigerem Umfeld (auch Joggen oder Radfahren helfen!), nach und nach sollte man die Höhe aber steigern. So tastet man sich in langsamen, kleinen Schritten vom Zwei- zum Drei- und dann zum Viertausender vor.
Zur Vorbereitung gehört auch, die passende Gruppe (für den Einstieg mit Bergführer*in) zusammenzustellen oder zu finden. Denn auch erfahrene Bergsteigende sollten nicht allein aufbrechen, schon gar nicht auf Touren mit Gletscherkontakt, Stichwort Seilschaft zur Vermeidung von Spaltenstürzen. Um diesen Schritt der Vorbereitung – zur Organisation von Gruppe und Bergführer*in gehört auch die Buchung von Schlafplätzen auf Hütten – sollte man sich frühzeitig kümmern. Denn viele Touren sind während der Saison hochfrequentiert.
Wer diesen Schritt auslagern möchte: Viele DAV-Sektionen und Bergschulen bieten nicht nur Kurse, sondern auch geführte Hochtouren an.
Was brauche ich für eine 4000er-Tour?
Solide Steigeisen sind für Viertausender in den Alpen eigentlich immer notwendig, genauso wie Pickel, Eisschrauben, Klettergurt und weitere Sicherheitsausrüstung wie Helm und Seil. Wer mit einer DAV-Sektion oder einer Bergschule unterwegs ist, bekommt die Ausrüstung bei Bedarf auch gestellt oder kann sie sich gegen eine Gebühr ausleihen.
Für Notfälle: Erste-Hilfe-Set und Zwei-Personen-Biwaksack. Diese kann man auch auf die Gruppe aufteilen.
Ausrüstungsinfo für Hochtouren

Ausrüstung auf (Sommer)Hochtour
Auf den Gletscher mit Steigeisen & Co
Der Grat zwischen zu wenig und zu viel Ausrüstung ist so schmal wie der Übergang vom Klein- zum Großglockner. Wir liefern die Grundlagen – Erfahrung perfektioniert das Setup.
Das Zwiebelprinzip ist bei Hochtouren genauso sinnvoll wie bei allen anderen Bergtouren: Als erste Schicht ein Kunstfaser- oder Merino-Shirt, drüber kommt eine atmungsaktive wärmende Schicht, zum Beispiel eine Fleece- oder Softshell-Jacke. Für Wetterumschwünge hat man eine wasserabweisende Hardshell-Jacke im Rucksack. Die Hose sollte mindestens windabweisend und nicht zu dünn sein – auch hier gibt es Softshell-Exemplare, je nach Wetteraussichten hat man vielleicht auch eine Hardshell-Hose dabei. Außerdem: Mütze, Buff und Handschuhe. Letztendlich hängt die Wahl der Kleidung aber von den persönlichen Vorlieben bzw. der eigenen Erfahrung beim Bergsteigen und der allgemeinen Wetterlage und dem Temperaturniveau ab.
Besonders wichtig bei den Schuhen: Sie müssen passen! Ansonsten sollten sie natürlich wasserdicht und bedingt (Kategorie B-C) oder sogar voll steigeisenfest (Kategorie D) sein.
Die Sonneneinstrahlung in großen Höhen ist nicht vergleichbar mit dem, was man im Tal oder in niedrigeren Lagen gewohnt ist. Daher: Sonnenbrille und -creme mit hohem UV-Schutz gegen Schneeblindheit und Sonnenbrand nicht vergessen!
Muss ich mich für einen Viertausender schon akklimatisieren? Und was hat es mit der Höhenkrankheit auf sich?
JA, Akklimatisation ist Pflicht – sonst droht die Höhenkrankheit. Bis 2500 Meter passt sich der Körper in der Regel sofort an, aber bereits ab 3000 Metern kann es zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Benommenheit, Übelkeit, Müdigkeit und Schwächegefühl kommen. Gerade sehr starke Kopfschmerzen in großer Höhe sind ein typisches Symptom einer Höhenkrankheit – was schon das Ende der Tour bedeuten kann. Richtig gefährlich sind das Höhenhirn- (HACE) oder Höhenlungenödem (HAPE). Während das Höhenhirnödem meist erst ab 5000 Metern auftritt und damit eher irrelevant in den Alpen ist, kann ein Höhenlungenödem schon ab 2500 Metern vorkommen. Dabei entstehen Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge, was ohne schnelle Behandlung oder sofortigen Abtransport nach unten lebensbedrohlich sein kann. Generell gilt, wenn man Symptome feststellt (Kopfschmerzen, die auch nach Schlaf/Pause auf gleicher Höhe/Schmerztablette (kein Aspirin!) nicht besser werden): Abstieg (in Begleitung) um mindestens 500 Höhenmeter!
Aber was kann ich tun, um mich vor der Höhenkrankheit zu schützen? Um entgegenzuwirken, muss man vor Ort eine Höhenanpassung, die sogenannte Akklimatisation, vornehmen. Zuhause kann man allerdings schon mal für eine gute Grundlagenfitness sorgen, dann ist die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Körpers besser.
Je nach Grundfitness sollte man dennoch drei bis sechs Tage für die Akklimatisation vor Ort einplanen. Ein empfohlener Ablauf für einen Viertausender wie den Gran Paradiso wäre zum Beispiel, am ersten Tag eine Tour aus dem Tal zu machen, die an der 3000 Meter-Marke kratzt, dann noch mal unten im Tal zu übernachten, denn dort erholt sich der Körper besser und schneller. Am nächsten Tag steigt man dann langsam zur Hütte auf, nachmittags kann man im Hüttenumfeld noch etwas höher steigen. Dabei kann man auch die Wege, die Hüttenumgebung erkunden, sich wichtige Punkte einprägen, denn die Gipfeltouren auf Drei- und Viertausender starten ja oftmals frühmorgens, wenn es noch dunkel ist. Am dritten Tag könnte man noch eine Zwischentour einfügen, zum Beispiel auf den Nachbarberg mit einer Höhe um die 3500, 3600 Meter (La Tresenta am Gran Paradiso). Dann ist man eigentlich bereit für die Strecke zum geplanten Gipfel und zurück.
Was muss ich unterwegs beachten?
Den frühen Start: Los geht’s für Viertausender meist mitten in der Nacht – jedenfalls so, dass man den Abstieg (zumindest den aus den Gletscherbereichen) im Laufe des Vormittags bereits wieder hinter sich hat. Denn das sind die Bereiche, die gegen Mittag, spätestens Nachmittag, bei schönem Wetter im Sommer gefährlich werden, wenn der Schnee aufweicht und die Spaltensturzgefahr zunimmt.
Den Himmel: Selbstverständlich startet man nur bei guter Wettervorhersage in die Tour. Aber auch unterwegs achtet man auf die aktuellen Verhältnisse – im Gebirge kann das Wetter schnell umschlagen.
Den eigenen Körper: In großen Höhen sollte man besonders auf die Signale des eigenen Körpers achten und die Fitness immer wieder hinterfragen. Das gilt auch für die äußeren Umstände: Passen die Rahmenbedingungen, passt die Gruppendynamik?
Hunger & Durst: Regelmäßiges Essen und Trinken sind gerade auf herausfordernden Touren wichtig. Beim Trinken sollte man eher mehr als gewohnt einplanen – durch die Höhe verdunstet mehr, der Körper braucht mehr Flüssigkeit.
Die Sicherheit: Und die Frage: Wann geht man am Seil? Faustregel: Auf einem schneebedeckten Gletscher geht man im Sommer am Seil, auf dem aperen, also blanken Gletscher und in Absturzgelände ohne Seil.
Empfohlene Artikel
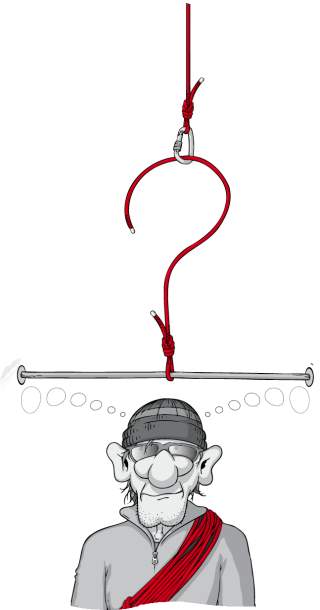
DAV-Sicherheitsforschung informiert
Seil oder nicht Seil? - Sinnvoll sichern...
Auf Hochtour jeweils die optimale Sicherungsmethode zu finden, ist komplex. Florian Hellberg stellt die Optionen vor und erörtert Vor- und Nachteile.

Spaltenbergung leicht gemacht
Raus aus dem Loch
Stürzt ein Seilschaftsmitglied in eine Gletscherspalte, kann das zu lebensgefährlichen Situationen führen. Die Kamerad*innenrettung ist unerlässliches Handwerkszeug auf Hochtour.
Wann ist überhaupt Saison für die Viertausender-Besteigung?
Tendenziell kann man sagen, dass sich die Hochtourensaison aufgrund des Klimawandels ins Frühjahr und in den Herbst verschiebt, konkret hängt es aber natürlich immer von der jeweiligen Tour ab. Ein Warnzeichen ist auch, wenn die Null-Grad-Grenze mehrere Tage lang über 4000 Meter liegt – dann sind schlechte Bedingungen erwartbar.
Der Klimawandel und die damit verbundene Gletscherschmelze sorgen auch dafür, dass sich die Übergänge vom Eis zum Fels verändern – und damit steiler, steinschlaggefährdeter, schwieriger werden.
Empfohlene Artikel

10 Empfehlungen des CAA
Sicher am Berg in Zeiten des Klimawandels
Was muss man heute bei der Tourenplanung und am Berg beachten? 10 Empfehlungen für den Umgang mit alpinen Gefahren in Zeiten des Klimawandels.

Klimawandel, Risiko und Bergsteigen
Veränderte Bedingungen in den Alpen
In den Alpen wird der Klimawandel beim Bergsteigen unübersehbar: Wenn Permafrost taut, werden Touren unmöglich oder zu riskant, Jahreszeiten sind nicht so verlässlich wie früher.

Bergsport im Zeichen des Klimawandels
Lohnt sich ein Hochtourenkurs noch?
Folge 45 des Bergpodcasts: Schmelzende Gletscher, Warnungen vor Steinschlägen & Extremwetterereignissen - worauf müssen wir uns als Bergsportler*innen einstellen?
Notfall – was tun im Fall der Fälle?
Passieren kann auf Tour immer etwas, das gilt für die Besteigung hoher Berge natürlich besonders – vom Spaltensturz und Absturz über Erfrierungen und Höhenkrankheit bis hin zu kleineren Verletzungen. Das Einmaleins der Ersten Hilfe sollten alle beherrschen, die am Berg unterwegs sind – das gilt sowohl für den Ablauf im Fall eines Notfalls als auch für konkrete Erste Hilfe-Maßnahmen. Wenn der Notruf unausweichlich ist: Als DAV-Mitglied bist du beim Bergsport rundum abgesichert. Hier gibt es alle Infos zu den Versicherungen im DAV.
Was kostet eine Tour auf einen Viertausender? Wo kann man sparen – und wo nicht?
Die allerersten Kosten, die für gewöhnlich für eine Viertausender-Besteigung anfallen, sind die für einen Hochtourenkurs. Für Kurse in DAV-Sektionen fallen für DAV-Mitglieder in der Regel zwischen 200 und 400 Euro für drei bis fünf Tage an, in Bergschulen wie dem Summit Club sind es meist über 1000 Euro für die einwöchigen Kurse. Hinzu kommen Anreise, Hüttenübernachtung und -verpflegung.
Apropos Hüttenübernachtung und -verpflegung: Hier gibt es Sparpotenzial. Mit einer DAV-Mitgliedschaft kommt die Hüttenübernachtung mindestens 12 Euro günstiger, außerdem kommt man in den Genuss des Bergsteigeressens zu einem ermäßigten Preis um mindestens 10% (maximal 11 Euro).
Nicht sparen sollte man hingegen bei der Ausrüstung. Gerade Schuhe und Steigeisen sind sicherheitsrelevant und sollten dementsprechend passen.
Wer keine Tour mit einer DAV-Sektion oder anderen Anbietern unternehmen möchte, aber eine professionelle Begleitung benötigt, kann auch eine Bergführer*in buchen. Hier muss man mit ca. 500-700 Euro am Tag rechnen, in der Gruppe kann man sich die Kosten teilen.









